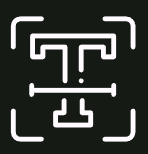Nach nun mehr als 17 1/2 Jahren als Konstruktionsingenieur und Statiker für Bewegungstechnik im Veranstaltungsgewerbe habe ich mich entschieden, ein neues Kapitel in meiner Biografie zu beginnen. Vielleicht ist es auch ein komplett neues Buch, dessen erste Seite ich in der nahen Zukunft zu schreiben beginne. Ich tausche mein Büro gegen ein Klassenzimmer, den Gong beim einstempeln in die Pause mit der Schulklingel und den Plotter gegen Kreide und Tafelschwamm. Meine Zukunft findet in Klassenräumen, Schulfluren und Lehrerzimmern statt. Diskussionen führe ich dann nicht nur mit mehr oder weniger erfahrenen Kollegen, sondern mit Schüler*innen, Eltern und Lehrerkollegen. Und das werde ich aus der Überzeugung heraus tun, dass ich Kindern etwas beibringen kann, was ihnen im Leben weiterhilft. Dabei will ich den Spagat zwischen dem, was mir als wichtig erscheint und dem, was Lehrpläne, Schulbücher und Regierungspräsidium vorgeben, schaffen. Mein zukünftiges Leben wird sich mit Problemen von pubertierenden Teenagern genauso auseinander setzten, wie mit der Korrektur von Klassenarbeiten und dem würfeln der Zeugnisnoten. Dabei will ich ein paar Punkte keineswegs vergessen:
- Ich war auch einmal Schüler (Teenager)
- Jeder ist in irgendetwas gut, und wenn dass nicht die Fächer sind, die ich unterrichte, muss dieser Jemand auch nicht alles wissen. Es reicht, wenn jeder sein bestes gibt.
- Ich bringe jedem und jeder den Respekt entgegen, der ihr oder ihm gebührt. Bist du unfreundlich zu mir, kann ich auch unfreundlich sein!
- Schleimspuren mag ich nicht! Nett sein, im Unterricht aufpassen und diesen mitzugestalten führen aber zu einem guten Ergebnis.
Es wird in den nächsten Jahren bestimmt auch Momente geben, an denen ich mich zurücksehne an meinen alten Arbeitsplatz, an dem ich meine Arbeitszeit für mich eingeteilt habe, an dem ich entschieden hab, in welcher Reihenfolge ich eine Aufgabenliste abarbeite, an dem ich entscheiden konnte, ob ich mal eben kurz im Internet etwas recherchiere und an dem ich entschieden habe, ob ich eine halbe Stunde früher nach Hause fahre oder doch eine Stunde länger machen will. In Zukunft gibt es einen festen Stundenplan für mich. Der weißt sicherlich auch die eine oder andere Freistunde vor, in denen ich etwas vor- oder nacharbeiten kann. Aber der Stundenplan sieht auch Konferenzen, Elternsprechtage und -abende vor. Aber anstatt wie bisher jeden Tag mindestens 30 Minuten Morgens und 30 Minuten Nachmittags im Auto sitzen zu müssen, weil es mit dem ÖPNV mehr als drei Mal so lange dauern würde um ins Büro zu kommen, werde ich in Zukunft innerhalb von 10 Minuten an meinem Arbeitsplatz sein. Und wenn ich etwas vergessen habe, kann ich noch mal schnell umdrehen und es holen und bin immer noch früh genug am Ziel. Anstatt wie bisher etwa 220 Tage im Jahr, werden es in Zukunft nur noch knapp 190 Tage sein, die ich zur Arbeit muss. Wenn man dazu berücksichtigt, dass es einmal in der Woche auch mal 20-30 Minuten länger dauert, sind das so nur noch 40 Stunden Fahrzeit im Jahr anstatt 242 Stunden. Das bedeutet knapp 200 Stunden mehr Quality-Time im Jahr. Wenn ich dann noch davon ausgehe, dass ich bisher an 220 Tagen zwischen 6 (freitags) und 8 Stunden (mo-do) im Büro verbringe plus 30 Minuten Pause kommen so 1782 Stunden im Jahr zusammen. Gehe ich nun von 8 Stunden pro Schultag an 190 Schultagen im Jahr aus, sind das 1520 Stunden. Also genau 262 Stunden weniger. Plus die 200 Stunden aus der Fahrzeit, sind das knapp 460 Stunden mehr Zeit für mich, meine Familie und für meine Freunde. Das sind mehr als 19 ganze Tage á 24 Stunden (!) oder 57 Tage mit je 8 Stunden Arbeit im Jahr weniger.
Sicher werden die ersten beiden Jahren bis zum 2. Staatsexamen kein Zuckerschlecken. Ich bin mir bewusst, dass ich dazu viel Zeit investieren muss, um ein guter Lehrer zu werden. Es gilt Unterrichtsstunden vorzubereiten, ein Plan für jede einzelne Unterrichtseinheit zu erstellen, Ziele für die Schülerinnen und Schüler festzulegen und Arbeitsblätter auszudrucken. Aber, den Vorteil habe ich gegenüber vielen Lehrern: Die Arbeit am PC ist mir nicht fremd. Ich kenne die Software, ich kenne gute Quellen im Internet und ich kenne ein paar erfahrene Lehrer, von denen ich mir jederzeit Tipps holen kann. Ich kann unter extremen Druck arbeiten (und erziele dabei die besten Ergebnisse) und kann, im aller schlimmsten Fall, wieder im meinen alten Beruf zurück wechseln. Ich bin weiterhin angestellter und zu nichts lebenslangem Verpflichtet.
Den wohl größten Respekt bei der Aufgabe habe ich vor den Schülern. Kinder, von denen viele lernen wollen, von denen einige lernen müssen und von denen einige nichts lernen wollen und die die Schule als eine Art Showbühne sehen, auf der sie sich vor einem Publikum profilieren können. Diese gilt es in den Griff zu bekommen und auf dem schmalen Pfad zwischen Oberlehrer und Kumpel zu einem Ziel zu führen, von dem sie noch nicht wissen, wo es sein soll. Sie sind wie ein roher, weicher Teig ohne jegliche Spannung, der von außen Schicht für Schicht in eine Form gebracht werden muss und aus dem am Ende eine prächtige Torte werden soll. Jede dieser Torten hat dabei eine andere Form, eine andere Füllung und einen anderen Geschmack. Als Lehrer hab ich dafür zu sorgen, dass kein Kuchen verbrennt oder halbgar die Backröhre des Lebens verlässt. Man kann bei der Verarbeitung dem Teig immer wieder zeigen, wie er einmal aussehen könnte und aus wie viele Ebenen die fertige Torte einmal bestehen könnte. Aber am Ende entscheidet der Kuchen selbst, ob er von anderen verspeist wird oder ob er als Meisterstück und als Vorbild für andere Torten genutzt werden will.
Ich für meinen Teil habe diesen Schritt mehr als gründlich überlegt und bin durch viele Gespräche und noch mehr schlaflose, aber gedankenreiche Nächte zu den Ergebnis gekommen, dass ich das Richtige tue. Meine Frau, meine Familie, meine Freunde und sogar meine Arbeitskollegen stehen geschlossen hinter mir. Ich werde nun Lehrer!